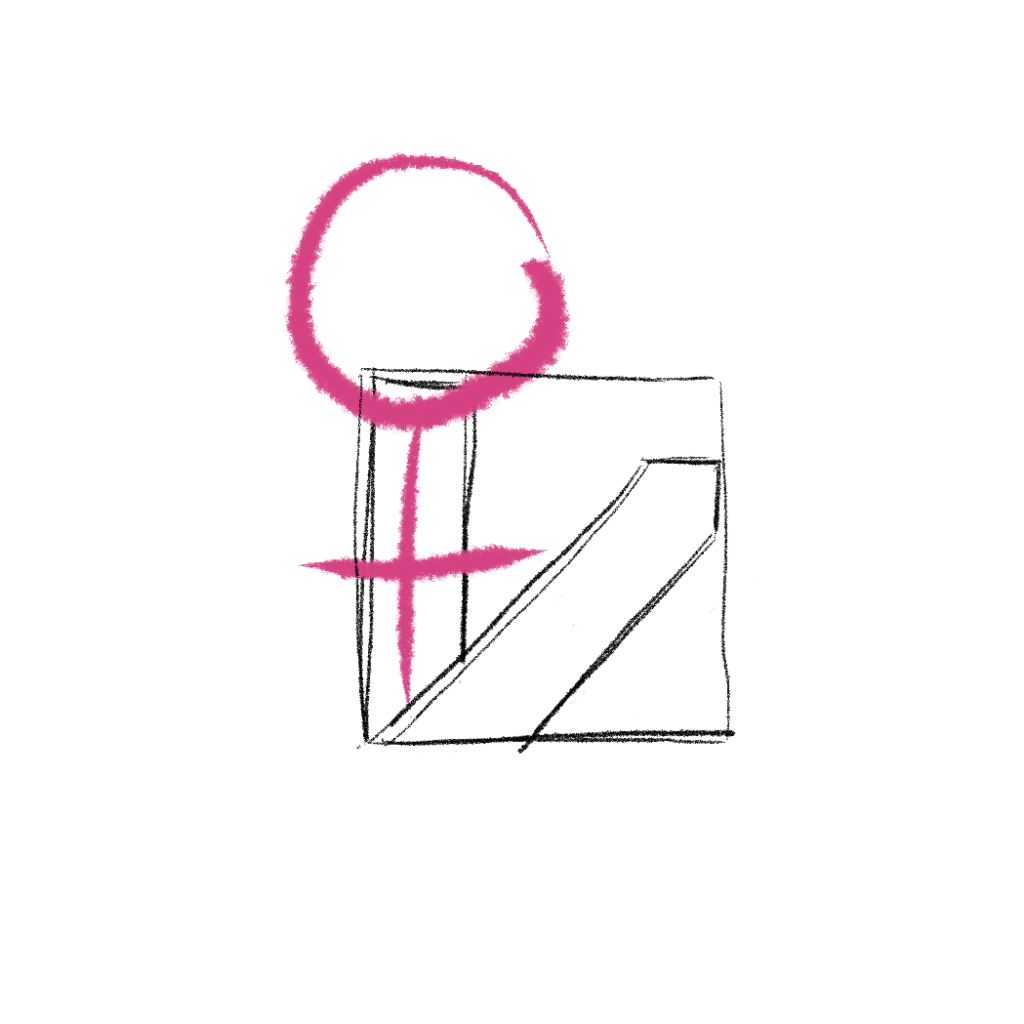Einmal Frauen hinzugeben und kräftig umrühren, bitte.
Patriarchat, Gender Pay Gap, Mansplaining – brauchen wir Feminismus? Brauchen wir ihn in Bayreuth? Um der Frage auf den Grund zu gehen, richten wir den Blick – was bietet sich mehr an – direkt auf unsere Universität. Wir nehmen unter die Lupe, was im Alltag oft untergeht: Frauen in der Wissenschaft.
Heute: Die Medizin
Gender Gaps gibt es zur Genüge. In der Medizin ist immer häufiger vom sogenannten Gender Health Gap die Rede. Damit beschreiben Mediziner:innen ihre Beobachtung, dass Männer im Schnitt zwar kürzer leben, Frauen dafür aber häufiger und länger krank sind. Erklärungsansätze gibt es viele: Frauen rauchen und trinken weniger und ernähren sich im Schnitt gesünder – auch weil weibliche Rollenbilder oft stärker mit “Self-Care” assoziiert werden. Gleichzeitig werden Frauen häufiger falsch diagnostiziert oder behandelt.
Lange war in der Medizin der männliche Körper der Standard. Egal, ob in anatomischen Zeichnungen, bei der Beschreibung von Symptomen oder in klinischen Studien: Der Mann und sein Körper wurden als repräsentativ für alle Menschen gesehen und das, obwohl es kein Geheimnis ist, dass Frauenkörper im Schnitt einen höheren Fett- und geringeren Körperwasseranteil und eine stärkere Durchblutung von Organen aufweisen. Das hat Folgen: Eine Studie aus dem Jahr 2001 zeigt, dass nur ein Viertel der 500 untersuchten Medikamentenstudien Frauen überhaupt mit einbezogen haben – oft lediglich damit begründet, dass man bei Frauen eine unerkannte Schwangerschaft fürchte und es aufgrund des Zyklus komplizierter sei, die Reaktionen eines weiblichen Körpers auf ein Medikament zu testen. Es ist daher wenig überraschend, dass Frauen stärker von Nebenwirkungen durch Medikamente betroffen sind und Symptome oft falsch eingeordnet werden. Erleiden 100 Frauen und 100 Männern einen Herzinfarkt, überleben durchschnittlich 80 Männer – aber nur 72 Frauen. Diese Nichtbeachtung von Frauen ist wohl vor allem ökonomisch motiviert: Eine getrennte Auswertung von Studienergebnissen kostet Zeit und Geld. Dabei werden selbst unter den Verfechter:innen einer solchen Ökonomisierung der Medizin Stimmen laut, die anmerken, dass eine geschlechtssensible Perspektive, die zu weniger Fehldiagnosen und passenden Behandlungen führen würde, langfristig profitabler ist.
Dass “frauenspezifische” Belange von der medizinischen Forschung und Lehre gekonnt ignoriert werden, ist kein Einzelfall. Auch über Krankheiten, von denen nur Menschen mit Uterus betroffen sind, ist wenig bekannt. So dauert zum Beispiel die Diagnose bei Endometriose, einer Krankheit, bei der sich Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen im Körper ansiedelt und zu starken, chronischen Schmerzen führt, in Deutschland im Schnitt 10 Jahre. In dieser Zeit leiden Betroffene und werden nicht selten unfruchtbar, während sie sich anhören müssen, dass “Schmerzen während der Periode doch total normal seien”. Erfolgversprechende Behandlungsmethoden gibt es noch kaum, da die Forschung hier ganz am Anfang steht.
Als wären mangelhafte Forschung und fehlende Testung nicht schon Problem genug, wird zudem noch immer oft angenommen, dass Frauen den Beruf der Ärztin weniger ernst nehmen als ihre männlichen Kollegen und bei der erstbesten Möglichkeit so schnell wie möglich den Chefärztinnen-Posten gegen die heimische Küche und Kinderbetreuen tauschen wollen. Der hierarchische, patriarchale und sexistische Krankenhausalltag mit fehlenden Teilzeitmodellen für Führungskräfte macht es Frauen quasi unmöglich, Arbeit und Privatleben zu vereinen.
Zum Glück ist schon 1969 aufgefallen, dass die Medizin nicht frei von Ungleichheiten ist. Damals formierte sich das Women’s Health Movement (WHM). Mit dem Ziel, das bestehende Medizinsystem und Zwei-Geschlechter Modell durch vielfältigere Perspektiven zu reformieren, war die Bewegung maßgeblich an der Entstehung der sogenannten Geschlechtermedizin beteiligt. In Folge wurden erstmals in breitem Umfang klinische Studien zur weiblichen Gesundheit durchgeführt und frühere Erkenntnisse in Frage gestellt. Heute wird die Geschlechtermedizin allerdings nur sehr punktuell betrieben oder im Studium gelehrt, die Charité in Berlin ist die einzige Universität mit einem entsprechenden Institut. Impulse für die weitere Entwicklung liefern stattdessen universitäre Gruppierungen wie die kritische Medizin. Sie setzen sich intensiv mit sexueller Selbstbestimmung und Schwangerschaftsabbruch auseinander – und damit mit Themen, die in der Lehre stark unterrepräsentiert sind. Durch Gesprächsgruppen und psychotherapeutische Angebote für Studierende bieten die Hochschulgruppen Raum für Austausch und schaffen dadurch eine Struktur zur Bekämpfung von Diskriminierung in der Medizin.
Der Weg zur Gleichberechtigung in der Medizin scheint noch lange und steinig zu sein, doch gerade Bewegungen wie das WHM und die kritische Medizin machen uns Hoffnung, dass wir bald noch viel mehr “FeministIN” aus dieser Disziplin teilen können.
FeministIN: Pille, Spirale, Hormonpflaster – Verhütungsmittel gibt es viele, Nebenwirkungen auch und fast alle nur für Frauen. Verhütungsmittel für Männer existieren kaum. Oft liegt das an fehlendem Geld für die Forschung oder – man(n) glaubt es kaum – an Nebenwirkungen. So wurde die Testung einer monatlichen Testosteronspritze, die die Produktion von Samenzellen unterbindet, beispielsweise eingestellt, weil die Männer über Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und Akne klagten. Ganz schön unfair, oder? Das dachten sich auch die Gründerinnen von “Better Birth Control”. Deshalb haben sie eine Petition gestartet, die gleichberechtigte Verhütung und bessere Aufklärung fordert. Stand heute: 70 000 Unterschriften. So kann es weitergehen!
FeministOUT: Ziemlich FeministOUT ist hingegen die neueste Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurts: Es hat die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel wegen “Werbung für Schwangerschaftsabbrüche” für rechtskräftig erklärt. Sie hatte auf der Website ihrer Praxis nicht nur darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sondern auch beschrieben, welche Methode sie dafür nutzt. Letzteres wird von Paragraph 219a unseres Strafgesetzbuchs unter Strafe gestellt. Durch dieses Informationsverbot wird Schwangeren das Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung genommen. Kristina Hänel will nun Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Wir stimmen ihrer Forderung zu: Paragraph 219a muss ersatzlos gestrichen werden!
- zwanzigdreiundzwanzig - 31. Januar 2023
- Dem Weltenbrand entgegen - 31. Januar 2023
- Klagen für’s Klima - 15. Dezember 2022